|
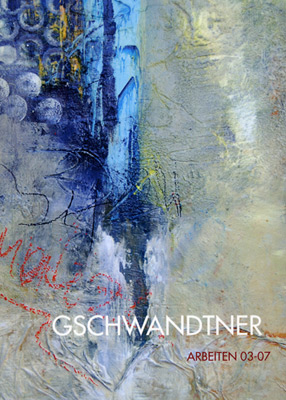
Das Buch ist zum
Preis von € 25,-
(exkl. Versand) direkt beim Künstler zu bestellen.
|
Wenn ihrs nicht fühlt,
ihr werdets nicht erjagen.
Goethe
Seit Menschen versuchen, Gedanken und Gefühle auszudrücken,
gibt es die "Kunst", gibt es das Abbild, das Lied,
den Tanz, die Zauberformel – der Einzelne möchte
den Anderen an seiner inneren und äußeren Existenz
teilhaben lassen.
Die Geologen haben das Alter von Höhlen- und Felszeichnungen
mit zehn- bis dreißigtausend Jahren bestimmt, die Zeichnungen
sind Mitteilungen über Lebensgewohnheiten und –notwendigkeiten,
über Fauna und Flora, mystische Deutungen ihrer Welt,
darin der unseren essentiell näher als temporär.
Auch der Impetus ist dem unseren ähnlich: Information,
Schmuckbedürfnis, aber auch tiefer schürfende Movens,
die von den Anthropologen noch nicht gänzlich erschlossen
sind.
Das Nachbilden von Vorbildern in der Natur war am Anfang.
Das Nachspüren hält an bis zu den bildenden Künsten
der Gegenwart: Epochen der Kunstgeschichte, Stilrichtungen,
Experimente, die sich durch Jahrhunderte ziehen, zeugen davon.
Jedes Kunstwerk erzählt davon. Und jedes Wort dieser
Erzählung ist "schön" – "ansehnlich"
war das althochdeutsche Wort dafür. Auch in der Malerei
spricht die Kunst des Künstlers zum Auge.
Die australischen Aborigines malen früher wie heute
ihre Mitteilungen und Nachrichten in geometrischen Darstellungen
auf verschiedene Malgründe, triviale wie auch mythisch-mystische
Apologe.
Immer wieder stellt sich uns die Frage: Was ist "Kunst"?
Ist es keine Kunst, Kunst zu erkennen? Schon in diesem Fragesatz
erkennt man wie different die Wortfamilie ist, aber eben auch
die Unterscheidung des schöpferisch Hervorgebrachten
vom bloß erzeugten. Welche Eigenschaften sind vonnöten?
Kann Kunst stationär sein oder ist sie immer progressiv?
Kann sie reaktionär sein oder gilt für sie die Sittenlehre
nicht? Ist sie "Kunst für die Kunst" und niemandem
verantwortlich, keiner objektiven Kritik preisgegeben? Wo
immer Reaktionäres zugrunde geht oder "Fortschrittliches"
überlebt, ist es eine Res publica. Wann aber erweist
sich, ob ein Kunstwerk in die Zukunft weist?
Aber ist Kunst nicht immer Avantgarde? Einer Epoche? Eines
Stils? Weil sie das, "was zu kommen hat" (so hat
es Rudolf Brunngraber einmal in einem anderen Kontext formuliert),
weil sie das, was zu kommen hat, was ungesagt, ungeformt in
der Luft liegt artikuliert und für alle verständlich
macht?
Der Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert war so eine
Zeit, in der sich vieles, von dem wir noch heute zehren, ankündigte:
durch Freud etwa und seiner Psychoanalyse, und durch Planck
und Einstein und durch den Untergang des Habsburgerreiches
nach einem verheerenden Krieg, dem ein verheerender Frieden
vorangegangen war – und beides trug schon den Keim des
nächsten Völkerkrieges in sich. Die Technik machte
die Welt kleiner, die Globalisierung warf ihre Schatten voraus,
die Automaten wachsen schneller als der Verstand.
In einer solchen Zeit konnte alles geschehen, alles, ohne
dass es viel Aufsehen erregte; weder der Thronwechsel in England
noch Lenins Schrift "Was sollen wir tun?" noch die
Hunnenrede des deutschen Kaisers und der Boxeraufstand der
Chinesen, den die Europäer niederschlugen, als wäre
es ihre eigene Provinz. Auch nicht die nihilistische Terrorwelle
in Russland. Der erste Zeppelin flog, und die Weltausstellung
in Paris vermittelte eine heile Welt.
In diese Zeit fiel ein effektiver Schritt der Malkunst.
Kandinsky postulierte den Anspruch der abstrakten Malerei.
Er forderte in seinen theoretischen Schriften die Abkehr vom
Abbild der Natur.
Latent war der Widerstand gegen den Akademismus, gegen die
strenge Komposition längst vorhanden, Alfred Kubin hatte
nach einem Blick in ein Mikroskop an der Verlässlichkeit
des Bildes gezweifelt, das wir mit dem Auge wahrnehmen; er
schuf eine Reihe von Bildern mit visionären Vorstellungen
aus seinem intuitiven Unterbewusstsein. Während Kubin
aber, wie auch in seinem Roman "Die andere Seite",
zum Surrealismus neigte, strebte Kandinskys Malerei die reale
Konstruktion an, wie er sie selbst gefordert hatte. Im Orphismus,
der von Apollinaire so getauften und von Delanay gemalten
abstrakten Manier trafen sich Kandinsky und andere Mitglieder
des Blauen Reiters – wenn auch verschieden motiviert,
so doch expressiv in der Farbe.
Der Terminus "abstrakte Kunst" ist oft kritisiert
worden, weil, wie man meint, alle Kunstwerke von der Natur
abstrahiert seien. Die vorgeschlagene Bezeichnung "gegenstandslos"
ist allerdings noch weniger stimmig, weil "Gegenstand"
eine Negation enthält, die dann vom Suffix auch noch
konterkariert wird.
Abstrakte Kunst hat sich allerdings für die neue Richtung
eingebürgert, wir wissen ja: nicht alles ist so wie es
heißt.
Immer wird es Künstler geben, die abseits des Mainstreams
ihren Weg suchen. In dem vorliegenden Oeuvre abstrakter expressionistischer
Malerei zeigt der Autor wie viel schöpferische Ressourcen
im minimalistischen Gebrauch von Fläche, Farbe und Strich
verfügbar werden. Farbe und Form finden eine Sprache,
die eine Korrespondenz mit dem Betrachter zulässt.
Der Künstler folgt nur der eigenen Intuition und Kreativität,
dem Zwang, malen zu müssen, und fordert den Betrachter
zur diskursiven Begleitung auf.
"Kunst" hieß in althochdeutscher Sprache
auch "Weisheit", das Wort stand im Gegensatz zur
Natur – offenbar schließt sich hier ein Kreis,
der mit der Abkehr vom Naturbild begonnen hat. und getrost
darf man auf den einleitenden Wahlspruch von Goethes Faust
verweisen: Wenn ihrs nicht fühlt, ihr werdets nicht erjagen.
Ich erinnere mich an den wunderbaren Satz, den vor Jahrzehnten
ein kluger Redakteur über einen Maler geschrieben hat:
"Er malt sich ein neues Leben."
Rudolf Praschek
zurück <<
Vorwort LA Mag. Georg Pehm >> |